Blättern Sie einfach über das Menü oben durch unsere Wissenssammlung zur besten Betreuung für Menschen mit Behinderung.
PERSÖNLICHE ASSISTENZ
für ein selbstbestimmtes Leben mit Behinderung
Das Modell der Persönlichen Assistenz zählt zu den vielfältigen Pflegeleistungen für Menschen mit Behinderung in Deutschland. Als Alternative zu herkömmlichen Betreuungsformen, wie vollstationären Pflegeheimen und der Betreuung durch Angehörige, rücken hier die individuellen Bedürfnisse und Wünsche der Assistenznehmer:innen in den Vordergrund.

Die Unabhängigkeit von Menschen mit Behinderung und deren gleichberechtigte Teilhabe am Leben bilden den Grundgedanken der Persönlichen Assistenz. Während die verordnete Unterstützung durch Dritte, die Pflege, der Selbstbestimmung sehr enge Grenzen setzt, gestalten Assistenznehmer:innen die benötigte Unterstützung nach deren eigenen Vorstellungen; sie nehmen eine aktive Rolle bei der eigenen Fürsorge ein, die Assistent:innen setzen ihre Anliegen lediglich um.
Mit seinen vielschichtigen Facetten ist das Thema Persönliche Assistenz auf den ersten Blick durchaus komplex. Deshalb haben wir die wichtigsten Informationen auf dieser Seite für Sie gebündelt:
Was ist Persönliche Assistenz?
Grundlagen der Persönlichen Assistenz

Die Persönliche Assistenz eröffnet Menschen mit Behinderung eine flexible Unterstützung, bei der sie das Ruder selbst in der Hand halten. Anders als bei der verordneten Pflege regeln sie als Assistenznehmer:innen ihre Hilfe selbstständig.
Mit der Persönlichen Assistenz treten Menschen mit Behinderung in die Rolle des autonomen Arbeitgebers. Im Arbeitgebermodell suchen sie eigenständig nach AssistentInnen, weisen sie in ihre Aufgaben ein, erstellen Dienst- sowie Pflegepläne nach eigenen Bedürfnissen und sorgen für die Bezahlung der Hilfskräfte.
Alternativ können sie auch die Dienste einer Assistenzorganisation in Anspruch nehmen, welche ihnen Assistent:innen zur Verfügung stellt und die Aufgaben des Arbeitgebers übernimmt. Diese Alternative wird auch als Dienstleistungsmodell bezeichnet und ist für alle diejenigen ratsam, die den hohen Verwaltungsaufwand scheuen.
Ein selbstbestimmtes Leben bedeutet, dass die Assistenznehmer:innen wesentliche Kompetenzen bei der Gestaltung ihrer Hilfe übernehmen:
Hilfebedürftige entwerfen die Assistenz nach ihren eigenen Vorstellungen. Sei es im Haushalt, bei der Arbeit oder während der Freizeit – sie bestimmen dabei den Leistungsrahmen, und zwar sowohl zeitlich, örtlich als auch inhaltlich. Das Ziel der Persönlichen Assistenz ist es, die Fremdbestimmung durch die autonome Teilhabe am Leben zu ersetzen.
Persönliche Assistenz in Berlin
Das Leistungsspektrum im Überblick
Das Modell der Persönlichen Assistenz setzt sich aus unterschiedlichen Einsatzbereichen zusammen. Ob in den eigenen vier Wänden, bei der Arbeit, in der Schule bzw. Ausbildung oder während der Freizeit. Menschen mit Assistenzbedarf legen selbst fest, wann, wie und wo sie Unterstützung benötigen. Die konkreten Leistungsinhalte und deren Umfang werden individuell zwischen den Assistenznehmer:innen, den Kostenträgern – auch trägerübergreifend – und deren Assistent:innen geregelt.
Arbeitsassistenz
Die Unterstützung am Arbeitsplatz wird unter dem Überbegriff der Arbeitsassistenz zusammengefasst. Alle Menschen mit Behinderung, unabhängig von der Schwere der Beeinträchtigung, können einen solchen Antrag stellen, auch wenn eine Einschränkung für Arbeitnehmer:innen erst droht. Das Ziel der Arbeitsassistenz ist es, die Integration in den Arbeitsalltag und die Teilhabe am Arbeitsleben zu fördern. Dabei erhalten Assistenznehmer:innen Unterstützung bei Aufgaben, welche behinderungsbedingt nicht eigenständig erledigt werden können. So wird gewährleistet, dass Assistenznehmer:innen ihrer beruflichen Tätigkeit am Arbeitsplatz barrierefrei nachgehen können. In diesem besonderen Fall der Assistenz übernehmen auch Versicherungen wie Rentenversicherung, Unfall- oder Krankenversicherung ganz oder anteilig die Finanzierung.
Pflegeassistenz
Der Fokus der ambulanten Pflege liegt auf der grundpflegerischen sowie der medizinischen Versorgung der Assistenznehmer:innen. Während die Lebensqualität in den eigenen vier Wänden gefördert wird, umfasst die medizinische Behandlungspflege alle Tätigkeiten, die auf ärztliche Verordnung durchgeführt werden. Darunter fällt beispielsweise die Wundversorgung, die Überwachung von Infusionen, die Medikamentengabe oder die Blutdruck- und Blutzuckermessung. Dank der ambulanten Pflege kann so, in Absprache mit dem behandelnden Arzt, ein Krankenhausaufenthalt vermieden werden.
Haushaltsassistenz
Können haushälterische Aufgaben nicht eigenständig bewältigt werden, schafft die Haushaltsassistenz Abhilfe. Die Leistungen der Haushaltsassistenz umfassen sämtliche Tätigkeiten, die in und um den Haushalt der Assistenznehmer:innen erledigt werden müssen. Hierunter fallen die täglichen Einkäufe, die Begleitung bei Spaziergängen, die Instandhaltung der Wohnräume, das Waschen, Kochen, die Korrespondenz mit Freunden, Familie und Ämtern sowie vieles mehr.
Schul- und Bildungsassistenz
Assistent:innen unterstützen Menschen mit Behinderung während der Schul- bzw. Ausbildungszeit, um deren gleichberechtigte Teilhabe am Bildungssystem zu ermöglichen. Die Hilfe richtet sich nach dem individuellen Bedarf der oder des Einzelnen. Sie umfasst Hilfe bei der Mobilität, der behinderungsbedingten Pflege, der Erledigung von Unterrichtsaufgaben und weiteren lebenspraktischen Bereichen. Grundsätzlich soll der barrierefreie Zugang zum Schulalltag ermöglicht werden. Schulassistenten arbeiten eng mit den Lehrkräften zusammen, um die Integration auch aus pädagogischer Sicht optimal zu gestalten. Bei einem Studium ermöglichen sie einem Menschen mit Behinderung den barrierefreien Zugang zu Bildungsressourcen und damit gleiche Chancen im Studium und bei der Bewerbung auf einen hochqualifizierten Job.

Freizeitassistenz
Zu einem selbstbestimmten Leben gehört auch die Freizeitgestaltung nach eigenen Wünschen, die durch Assistenz gefördert wird. Menschen mit Behinderung erhalten mit der Freizeitassistenz individuelle Hilfe bei ihren Hobbies, werden zu Veranstaltungen und Kulturangeboten begleitet und bei weiteren freizeitlichen Aktivitäten unterstützt. Eine weitere Form der Freizeitassistenz ist die Reiseassistenz. Hierbei begleiten Assistent:innen die Menschen mit Behinderung im Urlaub und bei längeren Ausflügen, so dass sie unterwegs genau die Hilfe bekommen, die sie brauchen.
Die hier gelisteten Assistenzbereiche schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern geben nur einen Überblick zu den verschiedenen Leistungsmöglichkeiten.
Finanzierung
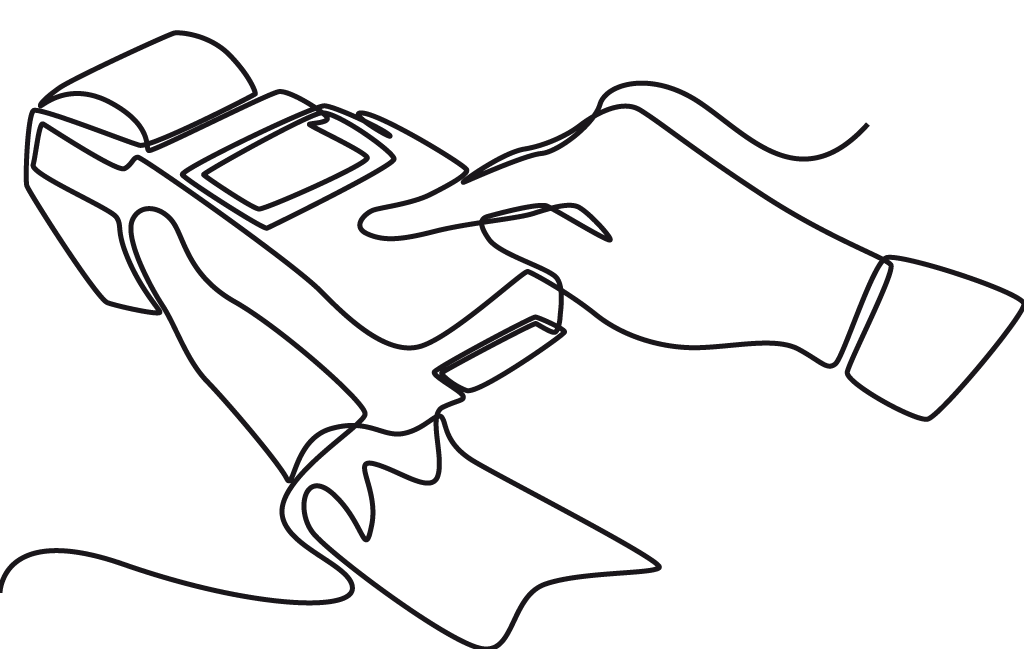
Das Persönliche Budget
In Deutschland kann die Persönliche Assistenz über das Persönliche Budget abgegolten werden. Hat man einen Anspruch auf Teilhabeleistungen, kann man das Persönliche Budget beim zuständigen Rehabilitationsträger beantragen. Als Alternative zu Dienst- und Sachleistungen wie sie etwa bei der Betreuung in einem Heim anfallen, stellt das Persönliche Budget eine Geldleistung dar. Assistenznehmer:innen erhalten monatlich ein bestimmtes Budget, das im Voraus mit den Leistungsträgern festgelegt und regelmäßig überprüft wird. Mit den zur Verfügung gestellten Geldmitteln wird die eigene Hilfe organisiert. Im Rahmen des Arbeitgebermodells werden Assistent:innen in Eigenregie gesucht, eingestellt, eingearbeitet und bezahlt.
Persönliche Assistenz in Eigenregie oder durch einen Dienstleister
Bei der Organisierung Persönlicher Assistenz gibt es zwei Modelle – das Arbeitgebermodell oder das Dienstleistungsmodell. Möchte man seine Assistenzhilfe durchweg selbstständig gestalten, ganz ohne fremde Hilfe, spricht man vom Arbeitgebermodell. Entscheidet man sich für die Persönliche Assistenz in voller Eigenregie, tritt man in die Rolle des Arbeitgebers mit allen Rechten und Pflichten, die üblicherweise ein Pflegedienst tragen würde.
Assistenznehmer:innen sind für die Anstellung per Arbeitsvertrag, das Anlernen, die Bezahlung der AssistentInnen sowie für alle damit verbundenen Organisations- und Verwaltungsaufgaben zuständig. Die Raumkompetenz, Finanzkompetenz, Personalkompetenz, Anleitungskompetenz als auch die Organisationskompetenz liegen im Arbeitgebermodell komplett bei den Assistenznehmer:innen.
Weiterlesen
Heutzutage gibt es vielfältige Möglichkeiten, eine passende Assistenzkraft zu finden. Über Bekannte, per Annonce oder Online. Im Internet gibt es eine breite Auswahl an Job-Portalen, in denen eine Stelle ausgeschrieben werden kann. Dazu eignen sich insbesondere Webseiten, welche auf die Persönliche Assistenz spezialisiert sind.
Das direkte Arbeitgebermodell verleiht Assistenznehmer:innen weitgehende Kompetenzen, ihre Assistenz autonom zu organisieren. Jedoch geht es mit großer Verantwortung einher, die eine zusätzliche Belastung darstellen kann. Möchte man die Vorteile Persönlicher Assistenz ohne den zusätzlichen Verwaltungsaufwand wahrnehmen, ist das Dienstleistungsmodell besser geeignet.
Bei dem Dienstleistungsmodell wird die Persönliche Assistenz durch eine Assistenzorganisation organisiert. Der Arbeitgeber der Assistent:innen ist in diesem Fall der zuständige Dienstleister, der auch die Organisation der Finanzen und des Personals übernimmt. Da das Personal beim Dienstleister eingestellt ist, fallen auch die Arbeitgeberrisiken praktisch ganz und die Verwaltungsaufgaben zum größten Teil weg. Was jedoch definitiv gleich bleibt, ist die uneingeschränkte Autonomie der Assistenznehmer:innen. Sie sind es, die über die Art und Weise, wie die Assistenzdienstleistungen erbracht werden, bestimmen. Und sie haben auch das letzte Wort bei der Auswahl der Assistent:innen, die in ihrem Team arbeiten – natürlich in Absprache mit diesen.
Arbeiten in der Persönlichen Assistenz
Das Berufsbild
Persönliche Assistent:Innen unterstützten Menschen mit Behinderungen und chronischen Krankheiten dabei, Hürden zu überbrücken, die sie selbst nicht nehmen können. Sie sind sozusagen die ausführende Hand der Assistenznehmer:innen. Ein einheitliches Berufsbild gibt es nicht, weil die Bedürfnisse von Person zu Person unterschiedlich sind. Zum anderen gibt es sehr unterschiedliche Bereiche, in denen Assistent:innen zum Einsatz kommen.
Ob im Haushalt, bei der Arbeit oder in der Bildung: Assistenznehmer:innen bestimmen selbst, wann, wo und welche Hilfe sie benötigen. Dementsprechend ist ein gewisses Maß an Flexibilität notwendig, um sich diesen individuellen Bedürfnissen anpassen zu können. Ganz wichtig ist, dass ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen beiden Parteien aufgebaut und gepflegt wird, so dass beide Seiten von dieser besonderen Beziehung profitieren können.
Welche Qualifikationen sind notwendig?
Um in der Persönlichen Assistenz arbeiten zu können, sind keine bestimmten Schul-, Ausbildungs- oder Studienabschlüsse notwendig. Dennoch: Belastbarkeit, Verantwortungsbewusstsein und Empathie sind Kompetenzen und Eigenschaften, die man als Assistent:in mitbringen muss. Alles Weitere wird von der betreuten Person selbst vermittelt, so dass alle Aufgaben nach deren Wünschen erledigt werden können. Schließlich sind Assistenznehmer:innen Experten in eigener Sache, sie wissen selbst am besten, was sie wollen und wie sie das erreichen.
Für einen einfacheren Start in das Berufsleben der Persönlichen Assistenz ist es trotzdem angeraten, erste Erfahrungen im Pflegebereich gesammelt zu haben: sei es in der Kranken- oder Altenpflege oder etwa durch Absolvieren eines Basiskurses Pflege.

Wie viel verdient man in der Persönlichen Assistenz?
Wie in vielen Berufen hängt das Gehalt vom jeweiligen Arbeitgeber ab. Im Regelfall liegt die Untergrenze beim Mindestlohn von derzeit 12,00 Euro. Dazu kommen Zuschläge für die Arbeit an Wochenenden, Feiertagen und in der Nacht von bis zu 135 Prozent.
Weiterführende Informationen
Hinter der Webseite „Ziemlich Beste Assistenten“ steht die Ausbildungsinitiative von Futura Berlin für Menschen, die Interesse an der Berufstätigkeit in der Persönlichen Assistenz haben. Diese Ausbildung ist insbesondere für Quereinsteiger:innen gedacht, die vorher in anderen Berufsfeldern gearbeitet haben und ein neues Betätigungsfeld suchen.
„Ziemlich beste Assistenten“ bildet diese Menschen im Rahmen einer 200-stündigen Basisqualifikation für ihre Arbeit als Assistent:innen aus. Das Besondere an dieser bislang einzigartigen Initiative ist der hohe Bezug zur Praxis. Die Assistent:innen werden berufsbegleitend ausgebildet und können das theoretische Wissen über medizinische, soziale, juristische und psychologische Grundlagen ihres Berufes sofort einsetzen.
Auf der Webseite beschreiben Assistent:innen ihren Berufsalltag, hier werden Fragen rund um den Beruf geklärt und weitere Informationen zum Assistenzberuf angeboten. Unter der Rubrik „Stellenangebote“ können Sie sich auch hier direkt als Assistenzhilfe bewerben.
Empowerment und Inklusion
Der Berliner Assistenzdienst Futura bringt mit seinem Musik gewordenen Slogan „Mitten im Leben leben“ Anspruch und Wirklichkeit einer optimalen Begleitung und Betreuung behinderter Menschen auf den Punkt.
Ein Miteinander auf Augenhöhe
Die Persönliche Assistenz ist aus dem Einsatz verschiedener sozialer Bewegungen behinderter Menschen hervorgetreten. In der Vergangenheit hatten Menschen mit Handicap keine andere Wahl, als die vorgesehene Hilfe Dritter – also in Pflegeeinrichtungen oder im Elternhaus – anzunehmen. Eine freie Lebensgestaltung war nicht möglich, die Teilhabe war eingeschränkt. Um das Leben in Eigenregie und als gleichgestellte Bürger:innen führen zu können, schlossen sich Aktivist:innen zu Bewegungen wie der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung zusammen. Ausgangspunkt waren die weltweiten Bürgerrechtsbewegungen, die in den sechziger Jahren für einen Umschwung in der Gesellschaft sorgten. Die Forderungen der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung lauten:
Aus diesen Grundgedanken ist auch in Berlin die Persönliche Assistenz entstanden, bei der behinderte Menschen die Kontrolle über die eigene Hilfe und Lebensgestaltung innehaben. Bis zur Bildung von Assistenznetzwerken sollte es noch etwas dauern. Futura Berlin gründete sich im Jahr 2000 als Initiative einer Gruppe von behinderten und nicht behinderten Menschen in Spandau.