Persönliches Budget
In Deutschland ist die Finanzierung der Persönlichen Assistenz über das Persönliche Budget möglich. Doch was genau ist das Persönliche Budget und wem steht es eigentlich zu? Hier erfahren Sie mehr.
Kerngedanke der Persönlichen Assistenz ist das Recht auf Selbstbestimmung und Teilhabe. Dementsprechend ist es Assistenzbedürftigen möglich, auch die Finanzierung dieser Leistung selbst zu regeln.
Menschen mit Behinderung haben in Deutschland einen Anspruch auf Assistenzfinanzierung, welche über das trägerübergreifende Persönliche Budget zugesichert wird. Anstelle vorgeschriebener Dienstleistungen erhalten Assistenznehmer:innen mit dem Persönlichen Budget Zugriff auf Geldleistungen. Dank dieser Mittel können sie ihre Hilfe eigenständig organisieren und abgelten. So wird das Wunsch- und Wahlrecht behinderter Menschen auch aus finanzieller Sicht gewürdigt.
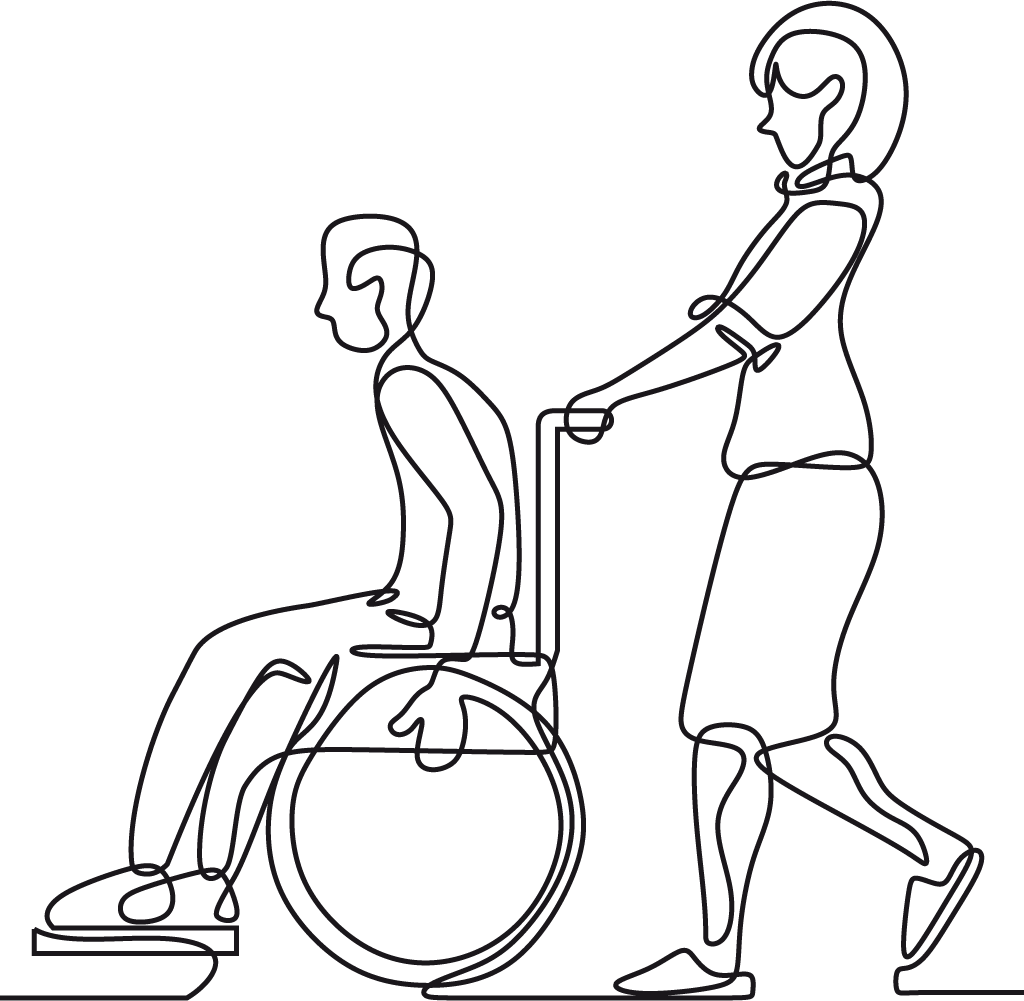
Wer hat Anspruch auf das Persönliche Budget?

Ob Arbeitgebermodell oder mit Assistenzdienst – Ziel ist ein so selbstständiges Leben wie möglich
Menschen mit Behinderung, einer chronischen Krankheit und jene, denen eine Behinderung droht, haben ein Anspruch auf das Persönliche Budget. Als Alternative zu den üblichen Sach- und Dienstleistungen können die notwendigen Leistungen mit dem Budget selbst eingekauft werden. Die Höhe des Persönlichen Budgets, welches im Normalfall monatlich ausgezahlt wird, wird im Voraus bei einer Budgetkonferenz festgelegt.
Da das Persönliche Budget trägerübergreifend ist, können im Einzelfall mehrere Leistungsträger zuständig sein. Die Budgetkonferenz legt deswegen auch fest, wer der formale Ansprechpartner für den Menschen mit Behinderung ist. Zwischen den Leistungsträgern und Leistungsempfänger:innen wird eine Vereinbarung getroffen. Diese gibt Auskunft darüber, welche Ziele mit dem Persönlichen Budget erreicht werden sollen. Außerdem schafft sie einen Rahmen für den Erfolgsnachweis, welcher von den zuständigen Trägern überprüft wird und von den Leistungsnehmern erbracht werden muss. Oftmals wird das Budget erstmalig für einen Zeitraum von einem Jahr bewilligt, um es nachträglich für die darauffolgenden Leistungsjahre anpassen zu können. Die Persönliche Assistenz bietet Leistungen zur Teilhabe, weshalb sie über das Persönliche Budget abgeltbar ist.
Mehr Verantwortung, mehr Risiken
Das Persönliche Budget versteht sich in der Regel als Arbeitgebermodell. Hier übernehmen die Leistungsnehmer:innen die Rolle des Arbeitgebers und tragen die volle Verantwortung für ihre Hilfe. Assistent:innen müssen eigenständig gesucht und eingestellt werden, sämtliche Arbeitsrechte müssen eingehalten werden. Ein zusätzlicher Verwaltungsaufwand, der auch mit hohen Risiken einhergeht. Ein Beispiel: Meldet sich die betreuende Assistenzkraft krank, muss eigenständig für eine Vertretung gesorgt werden. Dieser Verantwortung sollte man sich bewusst sein, bevor ein Auftrag auf Persönliches Budget gestellt wird.
Das Dienstleistungsmodell
Neben dem Arbeitgebermodell, in dem die Assistenznehmer:innen direkte Arbeitgeber sind, gibt es das Dienstleistungsmodell, das die Organisation und Verwaltung einem Assistenzdienst oder -Netzwerk überlässt. Gegenüber dem Persönlichen Budget im Arbeitgebermodell gibt es keine Nachteile, im Gegenteil. Die Selbstbestimmung bleibt im Rahmen der Persönlichen Assistenz vollends erhalten, wobei Verwaltungsaufgaben und Arbeitgeberrisiken abgetreten werden.

Die Assistenzkraft wird weiterhin eigenständig ausgesucht und eingearbeitet. Um die fristgerechte Bezahlung, Krankenvertretungen und weitere organisatorische Aufgaben muss sich nicht gekümmert werden. Diese Aufgaben werden von der Assistenzorganisation übernommen. So wird Assistenznehmer:innen zusätzliche Zeit eingeräumt, um sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Natürlich beruht das Dienstleistungsmodell mit einem Assistenzdienst auf einer gewissen Verbindlichkeit. Dennoch kann ein Mensch mit Behinderung auch zusammen mit seinen Assistent:innen das Netzwerk wechseln. Futura Berlin bietet diese Möglichkeit potentiellen Klient:innen an